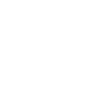Les moines de l’abbaye sise dans un haut-lieu de Bourgogne,
vous partagent leur recherche de Dieu :
• dans la foi, s’exprimant en louange divine,
• dans l’espérance de mériter d’avoir part à son Royaume,
• dans la charité, recevant les hôtes comme le Christ lui-même, en particulier lors de retraites.
Bienvenue à l’abbaye
Saint-Joseph de Clairval
à Flavigny-sur-Ozerain, France
Quel est l’homme qui cherche
vraiment Dieu ?
cf. Règle de saint Benoît, chapitre 58
Les Retraites
Cherchez et trouvez Dieu
grâce à une retraite s’inspirant
des Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola
dans le silence de la vie contemplative.
La Lettre Spirituelle
Si quelqu’un veut me suivre… (Mt 16, 24)
Laissez-vous entraîner à la suite du Christ avec les exemples des saints, grâce à la Lettre gratuite publiée par l’Abbaye.
= NOUS AIDER =
Soutenez nos projets de travaux
d’aménagement
Découvrez les projets d’agrandissement de l’abbaye par la construction de nouveaux bâtiments, et la manière de nous aider à faire face à ce défi important pour la vie de notre communauté monastique.
Visiter notre boutique
Vous trouverez dans notre boutique, entièrement gérée par les moines de l’abbaye Saint-Joseph de Clairval, un vaste choix d’articles religieux pour vos cadeaux de baptême, communion,
profession de foi, mariage, etc…